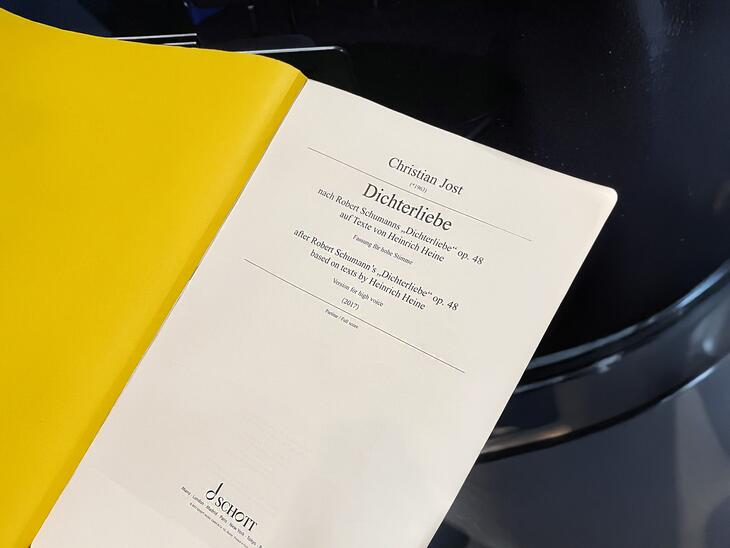Warum ist die Wahl für die nächste Produktion Deiner Opernklasse auf Humperdincks Hänsel und Gretel gefallen?
Bei der Entscheidung für ein Stück steht immer die Besetzung der Partien im Vordergrund. Hänsel und Gretel ist an ganz vielen Theatern im Repertoire und kommt alle paar Jahre auf den Spielplan. Es gibt darin einige Partien, die man oft bereits am Beginn der Karriere singt. Dazu gehören das Sand- und das Taumännchen aber auch die Titelpartien Hänsel und Gretel selbst. Außerdem gibt es reizvolle Charakterpartien, wie die Eltern und vor allem die Hexe; drei Partien, die man meist erst später singt, weil sie dramatischere Ansprüche an die Stimmen stellen.
Im Fall unserer Produktion an der Universität Mozarteum haben wir aktuell ein wunderbares Ensemble zur Verfügung und ich finde, dass wir alle Partien wirklich gut und fach-spezifisch besetzen konnten. Abgesehen davon macht die Arbeit an Humperdincks romantischer Oper allen Mitwirkenden einfach Spaß – das merkt man bereits jetzt bei den Proben. Die Musik selbst und die Arbeit an den Partien ist inspirierend. Ein letzter Grund: Hänsel und Gretel stand ganz viele Jahre lang nicht mehr auf dem Spielplan der Universität Mozarteum. Die Oper ist also einfach mal wieder dran.
Welchen besonderen Reiz hat diese Oper für Dich als Musiker? Welche Herausforderungen gibt es aus musikalischer Sicht für die Studierenden?
Innerhalb der Musikgeschichte des späten 19. Jahrhunderts stellt Humperdinck für mich das Bindeglied zwischen Richard Wagners Musikdramen und Richard Strauss dar, der die Uraufführung von Hänsel und Gretel dirigiert hat. Humperdinck hat sich über ein Jahrzehnt lang als Komponist aus Wagners Schatten befreit, nachdem er in Bayreuth intensiv an der Uraufführung des Parsifal mitgearbeitet hat. Aus seinem früher komponierten kindgerechten Märchenspiel Hänsel und Gretel für das Wohnzimmer wurde im Jahr 1892 ein abendfüllendes Werk mit Orchester für große Opernhäuser. Hier sehe ich die Herausforderung der Partitur: Kinder- und Volkslieder und den Märchentonfall einerseits mit einem spätromantischen Format und einem großen Sinfonieorchester in Einklang zu bringen. Dies gilt sowohl für die Interpretation der Partitur wie auch der Gesangspartien. Der Tonfall ändert sich rasant vom „Männlein im Walde“ zur groß auffahrenden Kantilene. Musikalisch ist die Oper in ihrer Ausprägung und in ihren Dimensionen ja tatsächlich eher ein Werk über Kinder als für Kinder. Bis die Hexe im dritten Akt endlich auftritt, haben die jungen Zuhörer schon viel Durchhaltevermögen beweisen müssen. Interessanterweise gilt die Oper ja als eines der Einstiegsstücke für junge Opernbesucher*innen und teilweise ist sie das natürlich auch – aber eben nicht nur.
Die Rollen sind alle doppelt besetzt. Wie groß ist der Interpretationsspielraum der einzelnen Sänger*innen ein- und derselben Rolle?
Der Gestaltungsspielraum unserer Studierenden ist riesig. Alle Mitwirkenden machen die Partien im Verlauf der Probenphase zu „ihren“ Partien. Dies gilt sowohl für die musikalische Interpretation wie für die szenische Darstellung auf der Bühne. Im Rahmen des Master-Studiums „Oper und Musiktheater“ bieten wir unseren Studierenden über zwei oder drei Jahre hinweg pro Semester eine ganze Fachpartie, welche sie gemeinsam mit uns Lehrenden erarbeiten und schließlich aufführen. Hierbei entwickeln sie ganz individuell ihre Herangehensweise an den bevorstehenden Berufsweg als Opernsänger*in. Zwischen dem ersten Aufschlagen des Klavierauszuges am Beginn des Partienstudiums bis zum Abschminken nach der letzten Vorstellung liegt der ganze Kosmos des Berufes und eine Fülle von Erfahrungen: wie lerne ich meine Rolle? Wie arbeite ich an der Sprache? Wie probe ich im Ensemble? Wie erarbeite ich mir die Partie stimmlich? Wie bringe ich Stimme, Musik und Darstellung zusammen, wenn es bei den Schlussproben ernst wird? Wie gehe ich mit meinen eigenen Erwartungen und allen anderen Erwartungen um? Wie gehe ich mit Erfolg und wie gehe ich mit schwierigen Situationen um? Wie finde ich mich zwischen all den vielfältigen Herausforderungen dieses „Traumberufes“ zurecht?
Unser Ansatz ist es, die Studierenden bestmöglich auf den anspruchsvollen Theaterbetrieb vorzubereiten und gleichzeitig die individuellen Persönlichkeiten jedes und jeder einzelnen zu fördern. Am Ende einer Produktionsphase ist es immer am schönsten, wenn die Studierenden das Gefühl haben, dass sie Teil eines harmonischen Ensembles geworden sind und gleichzeitig ihren persönlichen Zugang zur jeweiligen Partie gefunden haben – oder besser gesagt: die Rolle zu „ihrer“ Rolle gemacht haben. Im Fall von Hänsel und Gretel haben wir tatsächlich einen Besetzungs-Coup: die Partie der Hexe wird einmal von einer Mezzo-Sopranistin und einmal von einem Tenor gesungen. Also ein guter Grund, sich die Oper zweimal anzuschauen und zu erleben, wie unterschiedlich eine Rolle je nach Besetzung wirken und „klingen“ kann.
Die Oper wird in der Fassung für Kammerorchester von Alexander Krampe erklingen. Inwieweit verändert diese Reduktion die musikalische Gestalt der Oper im Vergleich zum „großen“ Klang von Humperdincks romantischer Originalbesetzung?
Darauf bin ich selbst gespannt. Ehrlich gesagt ist diese Fassung der Grund, die Oper überhaupt im Kontext der Ausbildung an unserer Universität aufzuführen. Die Partitur von Hänsel und Gretel kann so dick und laut sein, dass die Bühne es manchmal schwer hat, sich durchzusetzen – gerade im Repertoirealltag. Die Diskrepanz zwischen kontrapunktischem großen Wagner-Orchester im Graben und „leichten“ Stimmen auf der Bühne stellt auch große Häuser vor gar nicht einfache Besetzungsfragen.
Insofern war unsere Entscheidung für Hänsel und Gretel gleichzeitig auch eine Entscheidung gegen das große Sinfonieorchester – so sehr ich als Dirigent den Klang der originalen Partitur natürlich schätze. Im Kontext der Ausbildung steht die Bühne und die gesunde stimmliche Entwicklung unserer Studierenden im Vordergrund. Ich erhoffe mir von der Fassung von Alexander Krampe also Durchsichtigkeit und außerdem einen strukturellen Blick mit dem Brennglas auf die Partitur. Die reizvolle Aufgabe ist es, die Vielfarbigkeit der originalen Komposition mit lediglich 13 Instrumentalist*innen zum Klingen zu bringen und die großen sinfonischen Verläufe, die das Werk ja auch ausmacht, quasi „en miniature“ nachzuzeichnen.
Gibt es Produktionen der Oper aus der Vergangenheit, die Dich musikalisch besonders inspiriert/beeindruckt oder auch irritiert haben?
Nicht von ungefähr lieben viele Wagner-Dirigenten die Oper besonders. Das Nonplusultra der Hänsel und Gretel-Aufnahmen ist aus meiner Sicht Sir Georg Soltis Einspielung mit den Wiener Philharmonikern und einem großartigen Ensemble. Ich erinnere mich auch sehr gerne an eine Aufführung an der Wiener Staatsoper unter der Leitung von Christian Thielemann. Ich habe Hänsel und Gretel seit Beginn meiner Laufbahn sehr oft und immer wieder mal dirigiert. Sehr gerne erinnere ich mich an eine Inszenierung in Innsbruck von Brigitte Fassbaender, selbst ein sehr berühmter „Hänsel“. Dort habe ich als Gast die Oper erstmals dirigieren dürfen. Später habe ich gemeinsam mit dem britischen Regisseur Ultz eine sehr radikale und umstrittene Produktion erarbeitet, die bei der Premiere ein richtiger Skandal war. Ich stand voll und ganz hinter der Inszenierung und hatte das Gefühl, dass Humperdincks Musik selten so kitschbefreit und unmittelbar geklungen hat wie im Kontext jenes radikalen Settings. Manchmal erlebt man diese Musik als illustrativ und der Tonfall schwankt zwischen süßlich, dräuend und pathetisch – damals empfand ich sie als unmittelbar berührend und zutiefst menschlich.
Auf die bevorstehende Produktion im Dezember 2023 freue ich mich sehr und ich glaube, dass wir uns gemeinsam mit der Regisseurin Rosamund Gilmore auf eine sehr vielversprechende und spannende Lesart der Oper verständigt haben.